
19.01.2021, Mark Langguth
Lesezeit 20 Minuten
Die Vernetzung des deutschen
Gesundheitswesens erfolgt über die Telematikinfrastuktur (TI) als sicheres und
geschlossenes Netz, in das nur bekannte Akteure des Gesundheitswesens eingelassen
werden. Für die TI spielt der Konnektor eine entscheidende Rolle. Er ist die eine
Komponente, die u.a. für die Verbindung des lokalen Netzes einer Arztpraxis
oder anderen Einrichtung mit der zentralen TI verantwortlich ist. Entsprechend
muss jede Einrichtung, die an die TI angeschlossen werden will (oder muss),
über einen solchen Konnektor verfügen.
Die TI-Kritiker betiteln diesen
Konnektor als „Steinzeitkonnektor“, das BMG antwortet im Referentenentwurf des kommenden Digitale Versorgung und Pflege -
Modernisierungs-Gesetz (DVPMG) darauf mit dem Arbeitsauftrag an die gematik,
die Vorgaben für einen „Zukunftskonnektor“ zu erstellen – und allenthalben ist
zu hören, dass in diesem Zuge der Hardwarekonnektor durch einen reinen Softwarekonnektor
ersetzt werden soll. Dabei sollen die ungeliebten Karten, allen voran die eGK,
gleich mit verschwinden. Zu Zeiten des Smartphones seien sie ein Anachronismus
und gehörten nicht mehr in die moderne Zeit. Im DVPMG wird entsprechend auch
die Einführung „Digitaler Identitäten“ gefordert. Ab 2023 erst zusätzlich zu
eGK, HBA und SMC-B, sollen diese später dann gänzlich alleine ohne Karten
auskommen - wenn der Empfänger der digitalen Identität dies wünscht.
Der Wechsel von einem Hardware- zu
einem Softwarekonnektor bekommt insbesondere vor dem Hintergrund Dringlichkeit,
dass die Zertifikate der heutigen Konnektoren mit einer begrenzten Laufzeit von
5 Jahren ausgegeben wurden und werden. Die Zertifikate der Konnektoren laufen also
nach und nach ab, beginnend ab September 2022. Wird hier nichts unternommen, werden ab
diesem Zeitpunkt kontinuierlich Konnektoren, die älter als 5 Jahre sind, keine
Verbindung mehr zur TI aufbauen können – diese Konnektoren sind dann nicht mehr
nutzbar.
Aber was ist dran an der Idee, den
Hardwarekonnektor vollständig durch eine reine Softwarelösung zu ersetzen? Und
wo und wie wären diese Softwarekonnektoren ihren Hardwarekollegen eigentlich
wirklich überlegen? Oder hätten sie vielleicht sogar Nachteile? Und was hat es
mit den neuen „digitalen Identitäten“ auf sich? Kann man wirklich auf die
„Steinzeitkarte“ eGK verzichten und stattdessen nur noch z.B. das Smartphone
einsetzen? Auch für Ärzte und Einrichtungen?
Um diese Fragen sachlich bewerten
und beantworten zu können, müssen die unterschiedlichen Aspekte zu funktionalen,
wie sicherheitstechnischen Zielen des Konnektors und der Smartcards ebenso
betrachtet werden, wie die sich ab 2023 teilweise ändernden Anforderungen an
eine Anbindung an die TI bzw. eine Nutzung der Anwendungen der TI. Da die Liste
der Dinge, die für eine sichere digitale Vernetzung und digitale Interaktion im
Gesundheitswesen recht lang ist, heißt es jetzt: Bitte Durchhalten, damit am
Ende besser verstanden werden kann, welche Schlüsse gezogen werden können oder
sollten.
Ich kann Ihnen aber jetzt schon mitteilen, was Sie an
dieser Stelle sicherlich bereits vermuteten: Gar so einfach und schwarz/weiß,
wie es derzeit in der Politik und den Medien diskutiert wird, ist die Sache
nicht. Und ausgedient haben Hardwareboxen sowie hardwarebasierte digitale
Identitäten der Form eGK, HBA und SMC-B noch lange nicht, denn der
hardwarebasierte Lösungsansatz hat eine Reihe wichtiger Vorteiler, u.a. sind
diese sogar günstiger als ihre reinen Softwarelösungen – auch wenn dies
überraschen mag. Am Ende heißt es dann vermutlich: Nicht „Entweder-oder“
sondern „Sowohl als auch!“.
(Ungeduldige finden die Bewertung nach der Erläuterung in Abschnitt 6 des zweiten Teils dieses Artikels.)
Erläutern möchte ich entsprechend:
1. Ziele und technische Zusammenhänge
1.1 Ziele der digitalen Vernetzung im
Gesundheitswesen
1.2 Bedarf an sicheren Identitäten und Kryptografie
1.3 Verwendung von Kartenterminals und Krypto-Software
1.4 Nicht ohne öffentliche Zertifikate und
Vertrauensdiensteanbieter
1.5 Anforderungen an die sichere Vernetzung
1.6 Betriebsführung und Betriebsstabilität
1.7 Sicherheitskritische Anwendungsanteile
1.8 Zusammenfassung der Bedarfe
2. Konnektor – das „Schweizer Taschenmesser“ der TI
3. Kosten des Konnektors und der Smartcards
4. Nutzungs- und Einsatzszenarien der TI und ihrer Anwendungen
5. Gesetzesinitiative DVPMG
6. Auswirkungen auf den Konnektor, die Karten und
den ganzen Rest
7. Und nun?
Um aus einem digitalen Informationsaustausch einen sicheren digitalen Informationsaustausch zu machen, benötigt man kryptografische Verfahren, die
Hierfür erhalten die Personen bzw.
die Institutionen digitale Identitäten.
Das Mittel der Wahl für diese drei
kryptografischen Verfahren sind asynchrone Kryptoverfahren. Die Person / die
Institution hält einen privaten Schlüssel, zu dem ein passender öffentlicher
Schlüssel existiert. Klassischer Weise wird zu dem öffentlichen Schlüssel durch
eine vertrauenswürdige Stelle ein Zertifikat ausgegeben, in welchem bestätigt
wird, dass der Inhaber des privaten Schlüssels zu dem im Zertifikat enthaltenen
öffentlichen Schlüssel auch tatsächlich die Person / die Institution ist, die
sie behauptet zu sein und dass die behaupte Rolle dieser Person / Institution innerhalb
der Gesundheitsversorgung (Versicherter, Krankenkasse, Arzt, Zahnarzt,
Apotheker etc.) tatsächlich stimmt (mehr dazu später). Der private Schlüssel muss
dabei ganz besonders geschützt werden, denn jeder, der diesen privaten
Schlüssel nutzen kann, kann sich erfolgreich für die Person / Institution
ausgeben, welcher der Schlüssel eigentlich gehört. Entsprechend muss durch
technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden, dass diesen
Schlüssel tatsächlich nur sein Besitzer nutzen kann.
Dies führt dazu, dass diese
Schlüssel idealerweise in einem gesonderten Hardwarespeicher gehalten werden,
in dem die Schlüssel auch direkt verwendet werden, statt sie rein in Software
zu speichern oder für die kryptografischen Verfahren in einen PC oder Server zu
übertragen. Zusätzlich wird die Verwendung der Schlüssel in diesem Hardewarespeicher
durch Biometrie oder Kenntnis eines Geheimnisses (PIN) geschützt.
Die verbreitetsten Formen solcher
sicheren Schlüsselspeicher mit Kryptofunktionen sind:
Am komfortabelsten für gelegentliche interaktive
Nutzungsszenarien sind sicher Smartphonelösungen mit integriertem SE. Diese
setzen aber entsprechend voraus, dass die Person, die eine digitale Identität
nutzen muss, über ein entsprechendes Smartphone verfügt und es dafür auch
nutzen möchte. Ferner verlangt die Nutzung dieser SE-Lösung, dass der Anwender
mit seinem Smartphone interagiert, d.h. er muss es in der Hand halten und
entsperren, ansonsten könnte jeder, der im ergaunerten Besitz des fremden
Smartphones ist, sich in der digitalen Welt als dessen Eigentümer ausgeben.
Für das deutsche Gesundheitswesen
wird ferner eine Lösung benötigt, bei der alle Versicherten (also 80 Millionen Menschen), alle an der Versorgung beteiligten Personen sowie alle an der Versorgung beteiligte Einrichtung mit digitalen
Identitäten ausgestattet werden müssen (weitere Millionen Identitäten), da
ansonsten die Grundvoraussetzungen für einen sicheren digitalen
Informationsaustausch (zwischen authentisierten Personen und Institutionen) nicht
gegeben wären.
Es ist davon auszugehen, dass nicht wirklich
jeder Versicherte über ein Smartphone (mit SE!) verfügen wird oder
ein Smartphone hierfür verwenden will oder kann (denken wir alleine an die
vielen Menschen, die Betreuung benötigen). Entsprechend muss zumindest für eine
unbestimmte Anzahl der restlichen Personen ein anderer Schlüsselspeicher angeboten
werden. Auf Kostenseite ist hier die Smartcard unschlagbar. Daher ist sie auch für EC-Karten und SIM-Karten für das Telefon so
weit verbreitet und daher ist auch weitgehend jeder an die Bedienung und Nutzung
solcher Karten gewöhnt (Karte stecken und PIN eingeben). Es muss also zwingend
eine Kartenherausgabe für Versicherte etabliert werden. Hierfür könnte auch der
neue Personalausweis (nPA) als digitale Identität verwendet werden soll, den
bereits viele Bürger haben – aber eben nicht alle. Für die krankenversicherten
Personen, die keinen nPA haben bzw. keinen erhalten dürfen, sowie für
diejenigen, die einen nPA mit deaktivierter eID-Funktion haben, besteht entsprechend
weiterhin der grundsätzliche Bedarf für eine eGK. Und für medizinische Einrichtungen
könnte der nPA überhaupt nicht genutzt werden, da der nPA nur an Personen
herausgegeben wird, nicht aber an Einrichtungen. Hinsichtlich der Smartphonelösung
wird es ein Arzt im Arbeitsalltag sicher nicht zu schätzen wissen, wenn er für
jeden Vorgang, bei dem er sich als Arzt ausweisen und als Arzt unterschreiben
muss (z.B. zum Signieren der dutzenden Rezepte eines Tages), jedesmal sein
Smartphone zücken muss.
Egal ob nPA, eGK, HBA oder SMC-B: Die Smartcards müssen in ein Kartenlesegerät (KT) gesteckt bzw. an die Kontaktlosschnittstelle (NFC) eines Kartenlesegeräts angehalten / aufgelegt werden und verlangen eine PIN-Eingabe als Nachweis, dass es sich bei dem Kartennutzenden um den rechtmäßigen Inhaber der Karte handelt. Aber auch Smartphones, die digitale Identitäten in ihrem SE halten, werden üblicherweise per NFC des Smartphones an ein Kartenlesegerät gehalten, da die Smartphones eine virtuelle Smartcard simulieren. Sie kennen dies vielleicht schon von den neuen Bezahlmöglichkeiten à la Google Pay & Co.
Um ein Kartenlesegerät kommt man
folglich auch in Zukunft nicht drum herum. Das DVPMG fordert entsprechend
bereits, dass die im Einsatz befindlichen Kartenterminals des Gesundheitswesens
NFC-fähig werden und bestätigt damit den unverändert bestehenden Bedarf an
Kartenlesegeräten.
Aber ein KT operiert nicht für sich
allein. Es nimmt nur für die Smartcard PIN-Eingaben entgegen und vermittelt die
kryptografischen Operationen einer Smartcard (ob physische oder virtuelle
Smartcard) an die Software eines PCs – oder allgemeiner: an ein Gerät, auf dem
Software ausgeführt werden kann.
Die eigentlichen Kommandosequenzen, die erforderlich sind, um eine Smartcard bzw. ein Smartphone (via KT) als Identitäts- oder Rollennachweis, zur Signatur oder zur Entschlüsselung verwenden zu können, sind recht umfangreich und ihre korrekte Umsetzung in Krypto-Software entscheidet maßgeblich darüber, ob die resultierende Lösung nachher sicher oder angreifbar ist.
Dabei
fallen während dieser Kommandosequenzen temporär Informationen an, die ein
Angreifer keinesfalls erhalten darf, da die Sicherheit ansonsten ebenfalls
gefährdet wäre. Diese anspruchsvolle Software sowie idealer Weise auch das Gerät und Betriebssystem auf der diese
Software betrieben wird (ihre Ausführungsumgebung) müssen also entsprechend
vertrauenswürdig sein.
Es ist für die Sicherheit maßgeblich,
dass diese Krypto-Software nicht belauscht oder verfälscht werden kann. Sie
kann grundsätzlich auf einem normalen PC innerhalb der Einrichtung oder auch
auf dem PC oder dem Smartphone des Versicherten laufen. In beiden Fällen ist
eine Absicherung gegen Verfälschen und Belauschen schwierig, wie die
erfolgreichen Viren- und Ransomware-Angriffe auf PCs, Smartphones und Server
eindringlich zeigen. Alternativ kann die Krypto-Software auch auf einem
eigenständigen Gerät betrieben werden, welches ansonsten nicht für normale Interaktive
Nutzung sowie weitere Serversoftware zugänglich ist. Ein solches Gerät ist
derzeit der Konnektor. Er enthält
u.a. die Krypto-Software zur Steuerung der Kartenterminals sowie zu Nutzung der
Smartcards. Durch den isolierten Betrieb ist die dortige Krypto-Software
deutlich besser vor Manipulation und Abhören geschützt als in einem PC, Server
oder Smartphone.
Wie bereits oben angedeutet, reicht es für die benötigten Nachweise zur Identität und Rolle, zur Sicherung der Vertraulichkeit und Integrität nicht aus, nur einen privaten Schlüssel zu haben. Zu jedem privaten Schlüssel gibt es als Gegenstück den öffentlichen Schlüssel. Mit beiden zusammen können kryptografische Operationen durchgeführt werden: Ich, Mark Langguth, kann zum Beispiel ein Dokument mit meinem privaten Schlüssel signieren und jeder, der im Besitz des zugehörigen öffentlichen Schlüssels ist, kann anschließend prüfen, ob die digitale Signatur unter dem Dokument tatsächlich mit dem zugehörigen privaten Schlüssel durchgeführt wurde.
Dabei sind beide Schlüssel lediglich Bytefolgen ohne jegliche inhaltliche Aussage.
Für die verlässliche Nachprüfbarkeit auf Empfängerseite, dass tatsächlich ich,
Mark Langguth, das Dokument digital signiert habe und nicht irgendjemand, der
behauptet Mark Langguth zu sein, braucht es zu den öffentlichen Schlüsseln
zugehörige digitale Zertifikate, in denen neben dem öffentlichen Schlüssel auch
verlässlich vermerkt ist, dass genau dieser öffentliche Schlüssel zu Mark
Langguth gehört. Ferner benötigt die Vernetzung im Gesundheitswesen auch eine
verlässliche Aussage zur Rolle, in der eine Person oder Institution tätig ist. Wenn
es um mich in der Rolle als Versicherten geht, dann kann in diesem Zertifikat
auch bestätigt werden, dass ich aktuell ein Versicherter der Krankenkasse XY bin.
Bei einem approbierten Arzt Dr. Max Mustermann wäre im Zertifikat vermerkt,
dass er approbierter Arzt ist, bei einem Zertifikat der „Apotheke am Turm“,
dass es sich bei der Einrichtung wirklich um eine Apotheke handelt usw. Man
merkt schnell: Die Vertrauenswürdigkeit der Aussage, ob ein Schlüsselbesitzer
die behauptete Person bzw. behaupte Einrichtung in der behaupteten Rolle ist,
hängt von der Vertrauenswürdigkeit der Instanz ab, die diese Zertifikate
herausgibt. Das Gesamtsystem aus Schlüsseln und Zertifikaten wird als Public-Key-Infrastruktur (PKI) bezeichnet, die
Zertifikatsherausgeber nennt man Vertrauensdiensteanbieter.
Möchte man eine sichere digitale Kommunikation im Gesundheitswesen, braucht man
neben der reinen, sicheren Identitätsbestätigung (die für Personen z.B. auch
mittels nPA möglich wäre) auch die verlässliche Bestätigung der Rolle, in der
die Person tätig ist: Als versicherter Bürger Mark Langguth, als Arzt Dr. Max
Mustermann, als Zahnarzt, als Apotheker usw. Ferner benötigt man die sichere
Identitäts- sowie Rollenbestätigung auch auf Ebene der Einrichtung, also die Bestätigung
als „Arztpraxis Meier“, „Apotheke am Turm“, „Klinikum links des Rheins“ usw.
Ohne einen solchen Vertrauensraum, aufgespannt
durch die Zertifikate ausgestellt durch verschiedene vertrauenswürdiger Vertrauensdiensteanbieter,
die die einzelnen Akteure inklusiver ihrer Rollen bestätigen, gibt es keine
sichere und verlässliche digitale Vernetzung und Kommunikation.
Dabei ist die Vertrauenswürdigkeit
insgesamt auch davon abhängig, dass der jeweils zu einem Zertifikat zugehörige
private Schlüssel (samt PINs) garantiert die richtige Person bzw. Einrichtung erreicht.
Denn bin ich im Besitz des privaten Schlüssels und des Geheimnisses, um diesen
Schlüssel in seinem Schlüsselspeicher nutzen zu können, kann ich mich als die
diesem Schlüssel zugeordnete Person / Einrichtung ausgeben. Es wird also eine vertrauenswürdige Kartenherausgabe (bei eGK, HBA &
Co) bzw. ein vertrauenswürdiges Schlüsselrollout (bei Smartphone und HSM)
benötigt, welches sicherstellt, dass die privaten Schlüssel und ihre PINs
ausschließlich die richtigen Personen / Einrichtungen erreichen.
Wichtig zu wissen im Zusammenhang
mit den Zertifikaten ist ferner, dass diese mit einer maximalen Gültigkeit
ausgestattet werden. Dies liegt darin begründet, dass dem asymmetrischen
Kryptoverfahren über die Zeit eine Angreifbarkeit unterstellt wird. Auch wenn
diese eher hypothetischer Natur ist, werden daher die Zertifikate meist auf 5
Jahre Gültigkeit begrenzt. Mit Ablauf dieser Zertifikatsgültigkeit funktionieren die zugehörigen Schlüssel
natürlich immer noch. Nur die Vertrauenswürdigkeit über die korrekte Zuordnung
der Schlüssel zur Person / der Einrichtung gilt dann per Definition nicht mehr
als gegeben, weswegen mit Ablauf der Zertifikate die zugehörigen Schlüssel in
der Regel nicht mehr genutzt werden. In diesem Fall müssen neue Schlüssel und
Zertifikate ausgegeben werden. Ist ein Schlüssel zu einem abgelaufenen
Zertifikat auf einer Smartcard gespeichert, muss in der Regel die komplette
Smartcard ausgetauscht werden. Merken
Sie sich bitte diesen Umstand, er ist hinsichtlich der Frage nach der
Notwendigkeit eines Konnektoraustauschs von wesentlicher Bedeutung.
Anzumerken ist, dass neben der
klassischen zertifikatsbasierten Bestätigung von Identitäten und Rollen auch
online-Bestätigungsverfahren wie OAuth 2.0 eingesetzt werden können. In diesem
Fall wird die bestätigte Information zur Person und Rolle vom
Vertrauensdiensteanbieter nicht in einem statischen Zertifikat gespeichert,
sondern jeweils bei Bedarf online mitgeteilt. Der Bedarf für sichere
Schlüsselspeicher, sichere Herausgabeprozesse sowie Vertrauensdiensteanbieter
bleibt jedoch auch dabei erhalten.
Einrichtungen des Gesundheitswesens sollen sich untereinander erreichen und über Anwendungen direkt oder zeitversetzt versorgungsrelevante Informationen austauschen können. Der Gesetzgeber hat hierfür für das deutsche Gesundheitswesen die Telematikinfrastruktur (TI) vorgesehen.
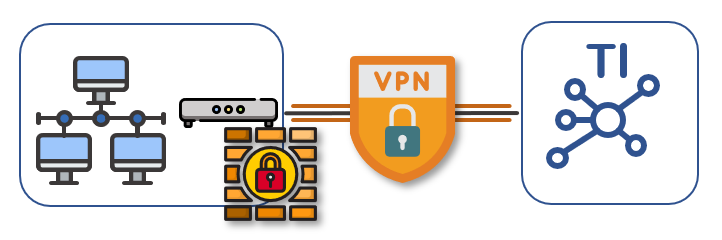
Ausgestaltet ist die TI
derzeit als sicheres, geschlossenes Netz, in welche nur berechtigte Nutzer des
Gesundheitswesens eingelassen werden. Der Inhalt des Netzes wird so vom Internet
abgeschottet. Solche geschlossenen Netze finden sich in vielen Bereichen, in
denen die Anwendungen innerhalb des geschlossenen Netzes vor dem Internet und
den dortigen Nutzern geschützt werden sollen. Beispielsweise bei dem „Sicheren
Netz der KVen“ (SNK) auf welches nur Ärzte und ärztliche Einrichtungen
zugreifen dürfen. Folglich muss beim Zugang zu einem solchen Netz geprüft und
sichergestellt werden, dass diejenige Person bzw. diejenige Einrichtung, die
auf das Netz zugreifen will, hierzu auf Grund ihrer Rolle auch tatsächlich
berechtigt ist. Entsprechend kommen für den gesicherten Zugang zur TI die
sicheren digitalen Identitäten zum Einsatz. Diese ermöglichen innerhalb der
einzelnen Anwendungen dann auch die sichere Protokollierung, wer auf welche
Gesundheitsdaten zugegriffen hat.
Für eine Anbindung an die TI muss
man ferner unterscheiden, welche Art von Zugriff im Einzelfall benötigt wird:
Sobald alle Mitarbeiter und
prinzipiell alle lokalen Geräte eines lokalen Netzes einer Einrichtung (hier
z.B. die PCs eines Praxis-LANs) auf Anwendungen in einem anderen, entfernten
Netzwerk zugreifen können sollen (hier Anwendungen in der zentralen TI), sind reine
sichere Einzelverbindungen (via TLS), werden nach Stand der Technik die lokalen
Netze mittels VPN (virtuelles
Privates Netzwerk) an das entfernte zentrale Netzwerk angebunden. Solche
VPN-Lösungen werden als reine Software oder in Form von VPN-Boxen angeboten. In
Einrichtungen haben reine Softwarelösungen den Nachteil, dass der PC / der
Server auf dem die VPN-Software läuft dauerhaft verfügbar sein muss und dieser
PC / Server nicht gestört sein darf. Daher hat sich bewährt für solche Fälle
besser eine hardwarebasierte VPN-Box einzusetzen. Da die VPN-Verbindung in der
Regel über das Internet aufgebaut wird, benötigt die Einrichtung einen
Internetanschluss. Damit die Einrichtung über diesen Internetanschluss nicht
gefährdet wird, muss der Internetanschluss der Einrichtung über eine Firewall abgesichert werden. Auch eine
solche Firewall kann als reine Softwarelösung auf einem PC / Server oder als
eigenständige Hardwarebox betrieben werden – mit den gleichen Vorteilen für
eine hardwarebasierte Firewall wie für die VPN-Box. Oftmals werden VPN und
Firewall als Lösung in einer gemeinsamen Box angeboten. Auf dem Markt
existieren viele Angebote für solche VPN+FW-Boxen. Die Preise für solche
VPN+FW-Boxen reichen von rund 200 € für sicherheitstechnisch unzertifizierte Geräte
bis 1.250 € für Geräte mit Sicherheitszertifikat – alles Preise für kleinere
Geräte, die für kleinere Einrichtungen geeignet sind. Bei der TI ist der Konnektor diese Box, die unter anderem VPN und
Firewall für die Kopplung des lokalen Netzwerks mit der zentralen TI
bereitstellt.
Wie bei den Krypto-Operationen mit
einer digitalen Identität ist auch die VPN-Verbindung eines lokalen Netzes mit
dem zentralen Netzwerk sicherheitskritisch. Auch die VPN-Software muss
entsprechend sicher implementiert und vor Manipulation geschützt betrieben
werden. Ferner benötigt diejenige Institution, die sich mittels VPN verbinden
will, eine digitale Identität, die sie als verbindungsberechtigte Institution
ausweist. Wie bereits ausgeführt muss eine solche Identität auf einem sicheren
Schlüsselspeicher gespeichert sein. Für die Verbindung eines Konnektors zur TI
kommen dazu eine im Konnektor verbaute Smartcard sowie die SMC-B der
Einrichtung zum Einsatz. Für einfache handelsübliche VPN-Boxen ist meist nur eine
reine Softwarelösung für die digitalen Identitäten verfügbar.
Krypto-Software sowie VPN und
Firewall werden im Kern immer als Softwarelösungen umgesetzt. Werden sie auf
einem PC oder Server betrieben, können diese Softwareteile von den Änderungen
des Betriebssystems betroffen sein. Mit jedem Patch, mit jeder neuen Betriebssystemversion,
mit jedem neuen Treiber, die auf den PC / den Server aufgespielt wird, muss die
Software für Krypto, VPN und Firewall gegebenenfalls angepasst werden bzw.
besteht die Gefahr, dass es zu Störungen kommt. Gleiches gilt für die weitere
Software, die neben diesen Anteilen zusätzlich auf dem Server bzw. dem PC
installiert ist und läuft. Auch diese weitere Software kann zu Störungen und /
oder Beeinträchtigungen der Krypto-, VPN- und Firewall-Software führen. Jeder,
der bereits einmal einen PC oder Server für längere Zeit als Admin betreut hat
weiß, wovon ich spreche. Aus diesem Grund vollziehen die großen Softwarehäuser seit
einigen Jahren den Wechsel von Software, die auf den PCs ihrer Kunden betrieben
wird, hin zu zentral bereitgestellter Software – Software As A Service (SAAS). Die Grundidee dabei ist, dass Aufwände,
Störungen und Kosten deutlich gesenkt werden können, wenn die Software nicht direkt
auf den unterschiedlichsten PCs mit unterschiedlichsten Störfaktoren betrieben
wird, sondern auf dem Anbieter bekannter Hardware und Betriebssystem unter der
Kontrolle der Anbieter (hier zentrale Server). Dem Anwender wird nur eine
Interaktionsmöglichkeit geboten, zumeist über Browser. Dies wird selbst bei so
umfangreichen und komplexen Anwendungspaketen wie Microsoft Office forciert.
Für sicherheitskritische Software,
die im Fall von VPN und FW insbesondere das lokale Netz gegenüber fremden
Netzen absichern soll, ist der Betrieb dieser Software auf zentralen Servern
natürlich nur begrenzt sinnvoll. Die Vorteile aber, die sich durch den Betrieb
der Software auf einer durch den Hersteller entwickelten und bereitgestellten „Box“
ergeben, sind denen von SAAS-Lösungen allerdings sehr ähnlich. Unter anderem
aus diesem Grund haben sich DSL-Modem- & Router-Lösungen in einer Box (z.B.
als AVM Fritz-Box) gegenüber Softwarelösungen auf PCs (mit eingebauten
Modemkarten) durchgesetzt.
Daher ist es zeitgemäß und sinnvoll
für sicherheitskritische Software, die keinerlei Interaktion mit anderen
Programmen oder dem Anwender benötigt, diese auf eigenständiger Hardware zu
betreiben. Meist reichen hierfür „kleine
Boxen“ aus, die im Vergleich zu heutigen PCs eine vergleichsweise geringe
Leistungsfähigkeit haben, für den Einsatzzweck aber mehr als ausreichend sind.
Auch können diese Boxen leichter für eine Remote-Administration geöffnet werden,
da auf diesen Boxen im Vergleich zu den Servern und PCs i.d.R. keine
personenbezogenen Daten gespeichert werden. Daher sind die
VPN+FW-Standardlösungen für kleine Einrichtungen entsprechend üblicher Weise auch
immer eigenständige VPN+FW-Boxen, z.b. von den Herstellern Genua, Juniper,
Cisco, Sophos und vielen weiteren.
Nun könnte man dagegenhalten, ob
ein geschlossenes Netz wie die TI oder das SNK überhaupt noch zeitgemäß ist
oder ob die verschiedenen Server für Infrastrukturdienste und Anwendungen nicht
auch – speziell gesichert – direkt im Internet betrieben werden können. Ein
Zugriff eines PCs oder Smartphone auf eine solche Anwendung wäre ja ohnehin
immer über einen TLS-Kanal gesichert. Diese Frage ist berechtigt und sollte für
die TI auch tatsächlich diskutiert werden. Aber auch wenn die Anwendungen und
Dienste der TI zukünftig direkt im Internet betrieben würden, müsste der
Internetzugang einer Einrichtung immer noch mittels Firewall gegen das Internet
geschützt werden. Der Bedarf für eine FW-Box bleibt daher auch in diesem Fall
erhalten.
Für einige Anwendungen der TI, insbesondere für die elektronische Patientenakte (ePA), existieren eine Reihe von Funktionen, die für das interoperable und insbesondere sichere Funktionieren der Anwendungen unerlässlich sind. Für die ePA ist beispielsweise das gesamte lokale Session- und Anwendungsschlüsselmanagement für die Sicherheit der ePA von großer Bedeutung. Wo diese Softwareanteile betrieben werden, ist wie bei VPN und Firewall letztendlich egal. Nur korrekt und sicher implementiert sowie sicher betrieben müssen sie werden. Im Falle des heutigen Konnektors werden diese Anwendungsanteile als sogenannte Fachmodule direkt auf dem Konnektor betrieben. Sie könnten natürlich auch als bereitgestellte Softwaremodule auf den PCs der Primärsysteme betrieben oder direkt in die Primärsysteme integriert werden. In diesem Fall müssten alle Primärsysteme (>300) um diese sicherheitskritischen Funktionen erweitert werden. Generell gelten auch für diese Anwendungsanteile die gleichen Herausforderungen der zuvor beschriebenen Betriebsstabilität. Im Unterschied zu VPN und Firewall könnten diese sicherheitskritischen Anwendungsanteile aber auch in zentrale Dienste innerhalb der TI ausgelagert werden und müssten nicht zwingend im lokalen Netz der Einrichtung betrieben werden.
Um eine sichere digitale Vernetzung und Kommunikation im Gesundheitswesen aufbauen zu können, benötigt man in Summe also:
Diesen Artikel teilen auf: